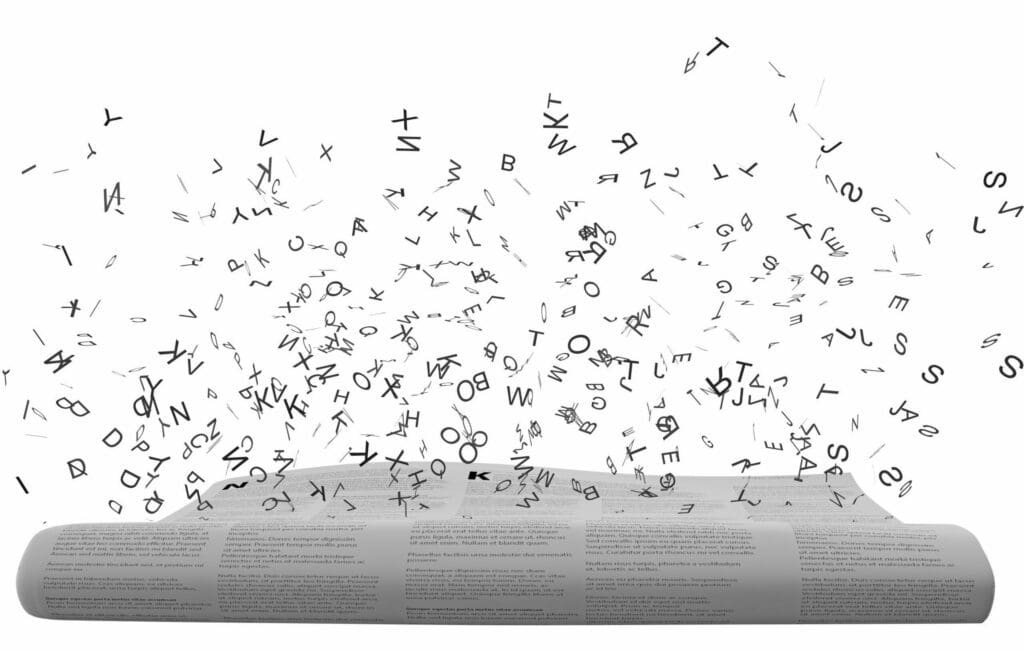
Mit diesem Teilbereich des Textes innerhalb der Sprachwissenschaft beschäftigt sich vornehmlich die Textlinguistik. Im Focus dieser steht die Untersuchung der Textstrukturen. Auch die satzübergreifenden Phänomene werden dabei behandelt. Auch Definitionen von Textsorten sind in diesem Rahmen erfasst.
Dabei ist die Beschäftigung mit der Definition der Texte und deren Aufbau wissenschaftlich gesehen noch relativ jung. Ein Text wird generell als Folge von Sätzen oder Äußerungen definiert. Die Bezeichnung hangt dabei eng mit der Sichtweise, die entweder aus der Pragmatik oder aus der Syntagmatik kommen kann, zusammen. Neben dem Sinnzusammenhang wird auch das Merkmal der Informativität stark durch einen Text ausgedrückt. Dies meint die Verteilung der Information auf den Text.
Eine systematische Untersuchung der Sinnzusammenhänge im Text führt zu dem Begriff der Kohäsion. Damit ist die systematische Untersuchung der Mittel in einem Text, die Sinnzusammenhänge herstellen. In der Sprachwissenschaft ist dies dann noch einmal verfeinert worden, sodass schließlich die zwei Begriffe Kohärenz und Kohäsion entstanden. Kohärenz ist dabei definiert als Zusammenhänge, die zwischen den Einheiten eines Texts bestehen. Der Leser, auch Rezipient genannt, kann sich diesen Zusammenhang durch seine kognitive Aktivität erschließen. Notwendig dazu ist ein gewisses Weltwissen des Rezipienten. Zeitliche, logische und referenzielle Beziehungen können so aufgedeckt werden. Diese Methode kommt den Bedürfnissen des Menschen nach dem Verstehen von Zusammenhängen nach. Um diese Inferenzprozesse in Gang zu setzen, muss der Text dem Prinzip der Sinnkontinuität genügen. In dieser Welt des Textes existieren Konzepte und Relationen. Wenn die Konzepte weniger explizit sind, hat der Leser einen großen Spielraum für seine Inferenzprozesse.
Kohäsion hingegen meint die Zusammenhänge, die durch sprachliche Mittel entstehen. Solche Mittel können auf unterschiedlichen Ebenen bestehen. Die lexikalisch-semantische Ebene weist lexikalische Wiederholungen auf und nutzt paradigmatische Beziehungen. Auf der Ebene der Syntax werden Abweichungen von der normalen Wortstellung möglich. Durch Konjunktionen werden die Sätze verstärkt miteinander verbunden. Zudem kann das Tempus die Sinnzusammenhänge definieren.
Die morphosyntaktische Ebene gibt Informationen in verdichteter Form wieder. So kann beispielsweise ein Nebensatz in einem folgenden Satz resümiert werden und zusätzlich durch ein Demonstrativpronomen verstärkt werden. Phonetisch kann ausgehend von der Lautung ein bewusster Gebrauch entstehen. Dazu können betonte Vokale dienen.
Der Begriff der Deixis beschreibt sprachliche Ausdrücke, die auf andere verweisen und somit Sinnzusammenhänge herstellen. Solche deiktischen Ausdrücke stellen Beziehungen zu unterschiedlichen Ausdrücken her. Dies können Ausdrücke sein, die den Ort, eine Person, oder auf die Zeit verweisen. Zudem können auch Verweise auf andere Elemente des Textes vorkommen. Dies Textdeixis unterteilt sich in Anaphern und Kataphern. Elemente, die rückwärts verweisen, heißen Anaphern. Kataphern hingegen sind Elemente, die nach vorne verweisen. In nahezu jedem Text tauchen auch Konnektoren auf. Auch sie sind in der Lage Kohäsionen herzustellen. Dies sind Satzverknüpfungen, die sich in Konjunktionen und Adverbien zeigen.
Textinformationen
Die Information im Text wird in der Wissenschaft als Mitteilungsperspektive von Äußerungen bezeichnet. Aus den 20er Jahren stammen die Begriffe Thema und Rhema, die der funktionalen Satzperspektive zuzuordnen sind. Der Ausgangspunkt des Textes ist dabei das Thema, während der eigentliche Gegenstand als Rhema bezeichnet wird. Die Thema-Rhema-Struktur bringt die Informationsstruktur hervor. Dabei findet eine binäre Aufteilung des Informationswertes statt. Jeder Satz setzt eine Information voraus, die damit präsupponiert ist. Diese ist immer die wenig wichtige Information, die damit thematisch ist. Die Behauptung im Satz ist dann das rhematische Element, das zudem gleichzeitig wichtiger ist.
Einteilung von Texten
Vor der strukturalistischen Textanalyse im 20. Jahrhundert teilte man die geschriebenen Texte in Textgattungen ein. Zu dieser Zeit ging es um die Beschreibung von literarischer Kunst wie bei Sophokles oder bei Corneille. Heute hingegen bezeichnen wir die oftmals genutzten Gebrauchstexte mit unterschiedlichen Ansätzen von Texttypen. Dieser deskriptive Ansatz beschreibt eine Kombination von Elementen. Die Kriterien, die dabei bestimmend sind, sind außertextliche Faktoren, welche die Situation der Kommunikation oder aber die Ebene des Rezipienten betreffen. Außerhalb des Textes können Situationen auftreten, die entweder gesprochen, geschrieben. Monologisch oder dialogisch sind. Der Rezipient kann in der Anzahl der Präsenz und der Gruppenzugehörigkeit variieren.
Hinzu kommt ein innertextuelles Kriterium. Darunter versteht man die thematische Entfaltung. Damit wird der Text differenziert. Geläufige Texttypen werden als deskriptiv, argumentativ, explikativ narrativ und instruktiv bezeichnet. Typische Sequenzen im Text können zu einer entsprechenden Einordnung beitragen. Die Narration ist an Sequenzen erkennbar, die temporal sind. Analytische Elemente kennzeichnen die Exposition. Die Argumentation zeigt sich durch ihre logischen Verknüpfungen und explizite Aufzeichnungen weisen auch die Instruktion hin.
Textformen
Textformen ergeben sich durch den Zusammenhang zwischen texttypischen Merkmalen und anderen Konventionen. Darunter fallen Formen wie der Roman, ein Witz, ein Bericht oder auch ein Wetterbericht. Ein Witz zählt zur deskriptiven Textform. Zudem ist diese Textform durch ihren Textanfang gekennzeichnet. Meist steht dafür die deutsche Inversion. Dennoch können immer auch Textvariationen auftreten.
Gerade wenn die Textform durch eine systematische Beschreibung gekennzeichnet ist, gestaltet sie sich sehr einfach. Umfangreiche Beschreibungen gibt es auch für Rezepte, Liebesbriefe oder Geschäftsbriefe sowie Bedienungsanleitungen. Längere Textformen können mit solchen Kriterien zwar nicht erklärt werden, dennoch können dynamische Relationen wie die Analogie und die Kausalität erkannt werden.
Im Zeitalter des Internets ist auch der Bereich der Analyse der Texttypen beschleunigt worden. Die automatische Textgenerierung dient heute der Erstellung von Texten, die in einer Vielzahl zur Verfügung sein müssen.
Zusammenfassung
Ein Text ist mehr als nur eine Sammlung von Sätzen; er muss einen Sinnzusammenhang und eine strukturelle Einheit aufweisen. Verschiedene sprachliche Elemente wie kausale Verbindungen, Demonstrativpronomen und Tempora tragen zur Textstruktur bei. Die Textlinguistik befasst sich wissenschaftlich mit der Analyse dieser Strukturen und satzübergreifenden Phänomene.
Die Konzepte der Kohärenz und Kohäsion sind entscheidend für das Verständnis von Texten. Während Kohärenz die inhaltlichen Zusammenhänge im Text beschreibt, bezieht sich Kohäsion auf die sprachlichen Mittel, die diese Zusammenhänge schaffen. Beide erfordern ein gewisses Maß an Weltwissen von Seiten des Lesers.
Texte können nach verschiedenen Kriterien klassifiziert werden, darunter Texttypen und Textformen. Diese Klassifizierung hat sich durch die strukturalistische Textanalyse im 20. Jahrhundert und die rasante Entwicklung der Internet-Textanalyse weiterentwickelt.
Die Information im Text wird oft durch die Konzepte Thema und Rhema strukturiert, die den Informationswert eines Satzes aufteilen. Dies ist besonders wichtig für die Informationsverteilung innerhalb des Textes.
Im digitalen Zeitalter hat die automatische Textgenerierung an Bedeutung gewonnen, insbesondere für die Erstellung von Inhalten in großer Menge.
Häufige Fragen und Antworten
Was ist ein Text und wie ist er aufgebaut?
Ein Text ist mehr als nur eine Ansammlung von Sätzen. Er besteht aus einem Sinnzusammenhang und hat eine strukturelle Einheit. Ein Text kann verschiedene sprachliche Elemente enthalten, wie kausale Verbindungen, Demonstrativpronomen und Tempora. Diese tragen zur Textstruktur bei und verleihen ihm einen aufbauenden Charakter.
Was sind Kohärenz und Kohäsion in Texten?
Kohärenz bezieht sich auf die Zusammenhänge, die zwischen den Einheiten eines Textes bestehen. Kohärenz ermöglicht dem Leser, logische, zeitliche und referenzielle Beziehungen zwischen den Sätzen herzustellen. Kohärenz hängt stark von der kognitiven Aktivität des Lesers und seinem Weltwissen ab. Kohäsion hingegen bezieht sich auf sprachliche Mittel, die diese Zusammenhänge schaffen. Das können lexikalische Wiederholungen, paradigmatische Beziehungen, Konjunktionen und andere sprachliche Elemente sein.
Wie werden Texte klassifiziert?
Texte können nach verschiedenen Kriterien klassifiziert werden. Das kann anhand von Texttypen oder Textformen erfolgen. Texttypen beschreiben die Funktion und den Zweck eines Textes, während Textformen sich auf die äußere Darstellung und Struktur beziehen. Typische Texttypen sind zum Beispiel deskriptive, argumentative, erklärende, narrative und instruktive Texte. Beispielsweise können Texte nach ihrer thematischen Entfaltung oder ihrer inhaltlichen Struktur klassifiziert werden.
